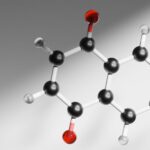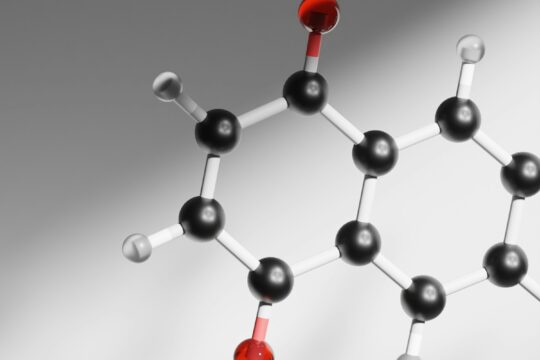Viele Menschen denken beim Zwerchfell in erster Linie an Atmung. Tatsächlich ist es unser wichtigster Atemmuskel – und gleichzeitig ein oft unterschätzter Baustein für Körperhaltung, Rumpfstabilität und funktionelle Bewegung. Wer sich mit chronischen Verspannungen, Rückenschmerzen oder hartnäckigen Muskelverletzungen – etwa an den hinteren Oberschenkeln (Hamstrings) – herumschlägt, sollte das Zwerchfell unbedingt genauer betrachten. Denn seine Rolle geht weit über die Atmung hinaus: Es beeinflusst massgeblich die Stellung des Beckens, die Verteilung des Drucks im Rumpf und damit auch das Gleichgewicht des Körpers.
Der vergessene Muskel im Zentrum des Körpers
Anatomisch liegt das Zwerchfell wie eine kuppelförmige Muskelplatte zwischen Brust- und Bauchhöhle. Es trennt die beiden Körperräume und bewegt sich bei der Atmung rhythmisch nach unten und oben. Viele wissen nicht, dass es aus quergestreifter Muskulatur besteht – das bedeutet: Es ist willentlich trainierbar.
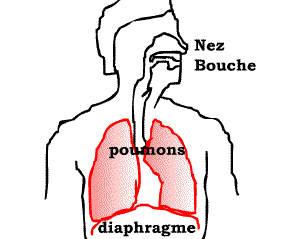 Pavol Grman, Spezialist für Atmung und Körperhaltung, nennt es in seiner Präsentation treffend „das Geheimnis der Stabilität“. Denn neben seiner Atemfunktion hat das Zwerchfell eine zweite, mindestens ebenso wichtige Aufgabe: die posturale Stabilisierung. Es hilft dem Körper, sich in seiner Mitte auszubalancieren und Bewegungen kraftvoll und sicher auszuführen. Und genau hier liegt der Schlüssel zur Haltung und zum Schutz vor Verletzungen.
Pavol Grman, Spezialist für Atmung und Körperhaltung, nennt es in seiner Präsentation treffend „das Geheimnis der Stabilität“. Denn neben seiner Atemfunktion hat das Zwerchfell eine zweite, mindestens ebenso wichtige Aufgabe: die posturale Stabilisierung. Es hilft dem Körper, sich in seiner Mitte auszubalancieren und Bewegungen kraftvoll und sicher auszuführen. Und genau hier liegt der Schlüssel zur Haltung und zum Schutz vor Verletzungen.
Haltung beginnt innen: Wie das Zwerchfell das Becken beeinflusst
Wer stabil stehen, gehen oder rennen will, braucht einen gut ausgerichteten Rumpf. Das Zwerchfell arbeitet dafür im Zusammenspiel mit der Beckenbodenmuskulatur, den tiefen Bauchmuskeln (vor allem dem transversus abdominis) sowie den kleinen Stabilisatoren entlang der Wirbelsäule (etwa dem multifidus). Dieses Netzwerk ist das funktionelle «Core-System», das den Körper aus der Mitte heraus organisiert.
Doch wenn das Zwerchfell nicht optimal ausgerichtet ist, verliert dieses System seine Kraft. Eine typische Fehlhaltung, die Grman beschreibt, ist das sogenannte Open Scissor Syndrome. Dabei kippt das Becken nach vorne, während der Brustkorb nach oben aufklappt – als würde man eine Schere öffnen. Diese Haltung bringt das Zwerchfell in eine schräge Position, wodurch es nicht mehr gleichmässig Druck im Bauchraum erzeugen kann. Die Folge ist eine instabile Wirbelsäule, eine Überlastung der Rückenmuskulatur und eine gestörte Bewegungsmechanik – vor allem in Sportarten mit hoher Belastung wie Fußball, Laufen oder Krafttraining.
Besonders gravierend wird diese Dysbalance, wenn sie dauerhaft bestehen bleibt. Das Zwerchfell kann dann seine stabilisierende Wirkung nicht entfalten, was zu einem «Zusammenbruch» der Rumpfstabilität führt. Bewegungen wie ein Sprint, ein Richtungswechsel oder ein Sprung werden durch Ausweichbewegungen kompensiert. Und hier kommen die Hamstrings ins Spiel.
Die Verbindung zu den Hamstrings: Wenn der Oberschenkel übernehmen muss
In der Praxis zeigt sich: Athleten, die unter dem Open Scissor Syndrome leiden, entwickeln über kurz oder lang Probleme mit ihren hinteren Oberschenkelmuskeln. Wenn das Zwerchfell nicht mehr richtig stützt, übernehmen andere Muskeln – etwa die Hamstrings – kompensatorisch die Aufgabe, den Rumpf zu stabilisieren. Diese Überlastung führt zu Verspannungen, Dysbalancen und nicht selten zu Muskelrissen.

Ein prominentes Beispiel ist Fussballspieler Raheem Sterling. Grman zeigt in seiner Präsentation, wie Sterling sowohl im Stand als auch im Lauf eine deutlich sichtbare Open-Scissor-Haltung aufweist – und tatsächlich verletzte er sich kurze Zeit später am Hamstring. Das ist kein Zufall, sondern biomechanisch erklärbar: Eine falsche Beckenstellung verändert die Zugrichtungen der Muskeln. Die Hamstrings arbeiten dann nicht mehr als reine Bewegungsausführer, sondern als Notstabilisatoren – eine Rolle, für die sie anatomisch nicht gemacht sind.
Das Missverständnis der „Bauchatmung“
Viele Menschen versuchen, ihre Atmung zu verbessern, indem sie gezielt „in den Bauch“ atmen. Doch das kann in die Irre führen. Bauchatmung ist nicht gleich Zwerchfellatmung – im Gegenteil: Eine übermäßige Betonung der vorderen Bauchdecke kann sogar zu strukturellen Problemen führen, wie Grman am Beispiel der Rektusdiastase (Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskeln) erklärt, die er sich selbst durch jahrelanges falsches Atemtraining zugezogen hat.
 Echte Zwerchfellatmung ist dreidimensional. Sie weitet den gesamten unteren Brustkorb – nach vorne, zur Seite und nach hinten. Nur so kann der intraabdominelle Druck gleichmässig verteilt werden, um den Rumpf von innen zu stabilisieren. Die richtige Atmung formt den Rumpf nicht zur Sanduhr, sondern zum Zylinder. Eine straff gezogene „Instagram-Taille“ mit ständig angespanntem Sixpack mag optisch wirken, ist aber funktionell ein Desaster. Sie behindert die natürliche Druckverteilung und damit die Fähigkeit des Körpers, sich zu stabilisieren.
Echte Zwerchfellatmung ist dreidimensional. Sie weitet den gesamten unteren Brustkorb – nach vorne, zur Seite und nach hinten. Nur so kann der intraabdominelle Druck gleichmässig verteilt werden, um den Rumpf von innen zu stabilisieren. Die richtige Atmung formt den Rumpf nicht zur Sanduhr, sondern zum Zylinder. Eine straff gezogene „Instagram-Taille“ mit ständig angespanntem Sixpack mag optisch wirken, ist aber funktionell ein Desaster. Sie behindert die natürliche Druckverteilung und damit die Fähigkeit des Körpers, sich zu stabilisieren.
Funktionelle Stabilität durch intraabdominellen Druck
Ein zentraler Begriff in Grmans Ansatz ist der intraabdominelle Druck – also der Druck, den das Zwerchfell in Zusammenarbeit mit Bauch- und Beckenbodenmuskulatur im Bauchraum erzeugt. Wenn dieser Druck gleichmäßig aufgebaut wird, entsteht eine innere Aufrichtung, die von außen kaum sichtbar, aber enorm wirksam ist. In dieser Position ist der Rumpf stabil, das Becken neutral, die Wirbelsäule aufgerichtet – und jede Bewegung läuft effizienter ab.
Diese Form der Stabilisierung wirkt sich nicht nur auf die Haltung im Stand aus, sondern überträgt sich direkt auf jede sportliche Bewegung. Wer sein Zwerchfell richtig trainiert, kann die Aktivierung des intraabdominellen Drucks in Alltagsbewegungen und Sportübungen wie Squats, Planks oder Sprints mitnehmen. Es entsteht ein funktionelles Zusammenspiel aller tiefliegenden Muskeln – und nur dann kann man wirklich von einem „starken Core“ sprechen.
Wie man das Zwerchfell richtig trainiert
Der Einstieg in das Zwerchfelltraining beginnt am besten in Rückenlage. Diese Position nimmt die Schwerkraft aus dem Spiel und ermöglicht es, sich ganz auf die Atmung zu konzentrieren. Grman empfiehlt, sich auf eine neutrale Beckenstellung zu achten (die Lendenwirbelsäule soll nicht hohl sein), die Knie anzuwinkeln und die Hände seitlich an den unteren Brustkorb oder an den unteren Rücken zu legen. Durch bewusstes Atmen in diese Bereiche lernt das Gehirn, neue Atemräume zu erschließen.
Ziel ist es, eine gleichmäßige, ruhige Atmung durch die Nase zu entwickeln – mit sichtbarer Bewegung der Hände beim Ein- und Ausatmen. Wenn die Atembewegung spürbar zur Seite und nach hinten geht, ist das Zwerchfell aktiv. Später kann diese Atmung mit gezieltem Druckaufbau kombiniert werden – zum Beispiel indem man die Hände auf den Bauch legt und einen sanften Widerstand gegen die Ausdehnung der Bauchdecke spürt. So entsteht gezielter intraabdomineller Druck, der mit jeder Einatmung stabilisierend auf den Rumpf wirkt.
Das Training ist simpel – aber nicht leicht. Viele brauchen Geduld, um alte Atemmuster loszulassen und die tiefen Strukturen neu zu aktivieren. Doch der Effekt ist gewaltig: Eine stabilisierte Mitte schützt vor Verletzungen, verbessert die Körperhaltung und macht Bewegungen effizienter und kraftvoller.
Fazit: Die Mitte macht den Unterschied
Das Zwerchfell ist weit mehr als ein Atemmuskel. Es ist das Kraftzentrum der Haltung, das Fundament funktioneller Bewegung – und ein unterschätzter Schutzmechanismus gegen Verletzungen, besonders an den Hamstrings. Wer es gezielt trainiert, verbessert nicht nur seine Atmung, sondern bringt auch Becken, Wirbelsäule und Muskulatur wieder in Einklang.
Ein funktionierendes Zwerchfell stabilisiert von innen, schützt vor Überlastung und bringt uns buchstäblich ins Gleichgewicht. Ganz gleich, ob man Leistungssportler ist, viel sitzt oder einfach nur besser stehen und gehen will – die Arbeit mit dem Zwerchfell lohnt sich. Es ist ein Muskel, der unser ganzes System organisiert – Atemzug für Atemzug.